Wie bringt man Menschen dazu, gemeinsam etwas anzupacken und Projekte für ihre Gemeinde umzusetzen? Ideen dafür liefert der Ansatz des „Social Design“. Mit dem richtigen Format verwandelt sich ein Theaterpublikum in eine Arbeitsgruppe oder ein hölzerner Dom wird zum Treffpunkt.
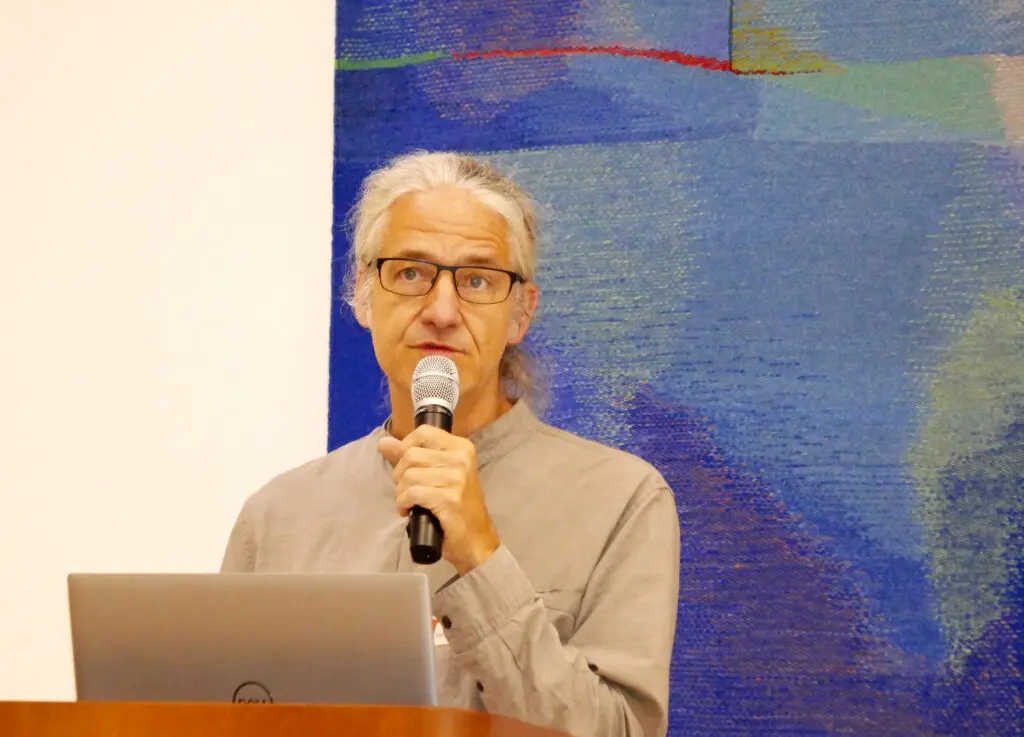
Design jenseits von Produkten und Marken
Design hat keinen guten Ruf, das weiß Christoph Rodatz. Schließlich diene eine neue Optik, zusammen mit dem Markennamen, in der Regel vor allem dazu, mehr Waren zu verkaufen, sagt der Theaterwissenschafler, der als Professor an der Bergischen Universität Wuppertal lehrt und forscht. Er trat als Gast beim ersten Dritte-Orte-Forum in Kiel auf (wir berichteten), bei dem es darum ging, die Idee der Dritten Orte als Keimzellen demokratischer Begegnungen bekannter zu machen. In Wuppertal befasst sich Rodatz mit Public Interest Design, zu Deutsch etwa Gemeinwohl-Design. Diese noch neue Fachrichtung befasst sich mit den Fragen der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wie sieht Kommunikation in einer zunehmend gespaltenen Bevölkerung aus? Und noch mehr: Wie kommen überhaupt Personen zusammen, die bereit sind, miteinander zu sprechen?
Design im klassischen Verständnis kombiniere die Funktion eines Gegenstands oder Kleidungsstücks mit dem Aussehen und einer emotionalen Wirkung, erklärte Rodatz: „Ein Stuhl ist ein bequemes Sitzmöbel. Aber er kann darüber hinaus auch schick sein und etwas ausstrahlen, etwa Eleganz oder Leichtigkeit.“ So eine Wirkung wolle auch das Public Interest Design erzielen. Aber anders als beim Mode- oder Industriedesign geht beim Gemeinwohl-Design nicht, einem Gegenstand eine neue Form zu geben. Stattdessen geht es um die Gestaltung von menschlichen Begegnungen.
Will ich, dass Menschen nur zuhören oder mitmachen?
Dafür braucht einen Raum, zum Beispiel einen, der Kunst und Kultur an ungewöhnliche Orte holt. Und wie der Raum aussieht, bestimmt mit, wie eine Begegnung verläuft. Wer zum Beispiel einen sehr langen Tisch aufstellt, sich selbst ans Kopfende setzt und dem Gast einen Platz am Fußende zuweist, trifft damit eine andere Aussage, als wenn alle Beteiligen an einem runden Tisch sitzen. Oder gar nicht sitzen, sondern stehen und von Tisch zu Tisch wechseln können. Die Atmosphäre eines Raums und einer Diskussions-Situation könne Menschen und Gruppen ausschließen oder einladen. Auch was bei einer Veranstaltung weiter passiere, sei kein Zufall. „Will ich, dass die Leute zuhören oder mitmachen?“, fragte Rodatz. „Das lässt sich durch die Raumgestaltung beeinflussen.“
Das „social design lab“, ein Projekt der Hans-Sauer-Stiftung in München, hat sogar einen ganz eigenen Raum kreiert, der zu Begegnungen einlädt. Der „Habibi Dome“ ist eine kuppelförmige Holzkonstruktion, die etwa in einer Fußgängerzone aufgebaut werden kann. Zwischen 2020 und 2024 stand der Dom in verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen. „Ziel war es, Menschen und Organisationen unter dem Dome zusammenzubringen, um den nachbarschaftlichen Austausch zu fördern und einen einladenden Raum für Veranstaltungen, Vernetzung, Diskussion und Inklusion zu schaffen“, heißt es auf der Homepage des „social design lab“. Dahinter steht ein Gruppe von Personen, die bundesweit Projekte umsetzt.

Public Interest Design im Blick der Wissenschaft
Neu ist die wissenschaftliche Befassung mit Social Design oder eben, wie es in Wuppertal heißt: Public Interest Design. Das Fach ist der Abteilung Mediendesign und Raumgestaltung zugeordnet. In dem Masterstudiengang stehe die faszinierende Vorstellung im Mittelpunkt, durch Design an der Gestaltung der Gesellschaft und öffentlichen Angelegenheiten teilhaben zu können und über eigene Projekte das Interesse am Öffentlichen zu gestalten, heißt es auf der Homepage des Studiengangs.
Thematisch könne es um alles gehen, was dem öffentlichen Interesse, also dem Gemeinwohl diene, erklärte Rodatz. Der Studiengang sieht Menschen als Bürger:innen und Expert:innen des Alltags, die sich mit ihren Ideen einbringen.
„Das Themenfeld reicht von globalen Fragen wie dem Klimaschutz bis zu Dingen, die nur die direkte Nachbarschaft betreffen.“
Ein Gebäude für alle – aber wie reden alle mit?
Als Beispiel schilderte Rodatz das Pina-Bausch-Zentrum in Wuppertal, das Vermächtnis der Tanz-Legende Pina Bausch. Bausch hatte sich gewünscht, dass nach ihrem Tod der „Tanz weiter einen Platz in Wuppertal behält“, so steht es auf der Homepage des Projekts. Entstehen soll ein Gebäude, das dem Tanztheater eine feste Spielstätte bietet und ein Pina-Bausch-Archiv enthält. Darüber hinaus sollen die Räume öffentlich genutzt werden dürfen. Damit käme der Raum der ganzen Stadt zugute, nicht nur Fans des Tanztheaters.
„Ein toller Schachzug, um das Gebäude zu nutzen und gleichzeitig zu öffnen“, findet Rodatz. Die Frage lautete aber: Wie erfährt die Stadtgesellschaft von dem Projekt, wie lassen sich Bürger:innen dafür gewinnen, über das Gebäude und seine Nutzung nachzudenken? „Public Interest Design findet kreative Wege, die Menschen aus verschiedenen Milieus zusammenbringen“, ist Rodatz überzeugt. „Es schafft Formate der Interaktion.“
Erst ein Theaterstück, dann ein Workshop, dann ein Bürgerrat
Im konkreten Fall erstellten Studierende und Künstler:innen ein Info-Theaterstück, das eine mögliche Zukunft des Gebäudes zeigte. Das Stück wurde mehrfach aufgeführt und erreichte mehrere Hundert Zuschauer:innen. Nach jeder Aufführung wurden die Gäste zu einem Workshop eingeladen, um weiter über das Thema zu diskutieren und die Vision in die Tat umzusetzen. Aus dem gut besuchten Workshop entstanden mehrere Arbeitsgruppen, die über bestimmte Unteraspekte sprechen und weiter regelmäßig tagen.
Beim Wuppertaler Beispiel gab es nur ein Problem: Die Gruppe derer, die in den Arbeitsgruppen weiter mitarbeiten, war zu homogen, um die gesamte Stadtgesellschaft wirklich abzubilden. Darum wurden in einem weiteren Schritt Personen zu einem Bürgerrat eingeladen, deren Namen per Losverfahren ermittelt wurden. Auch so ein Format ist ein Beispiel für Social Design, weil es dazu beiträgt, Minderheiten zu beteiligen, die ohne direkte Einladung nicht zu so einem Gesprächsformat dazustoßen würden.
Mehr über das Dritte-Orte-Forum in Kiel lesen Sie in diesem Beitrag:
